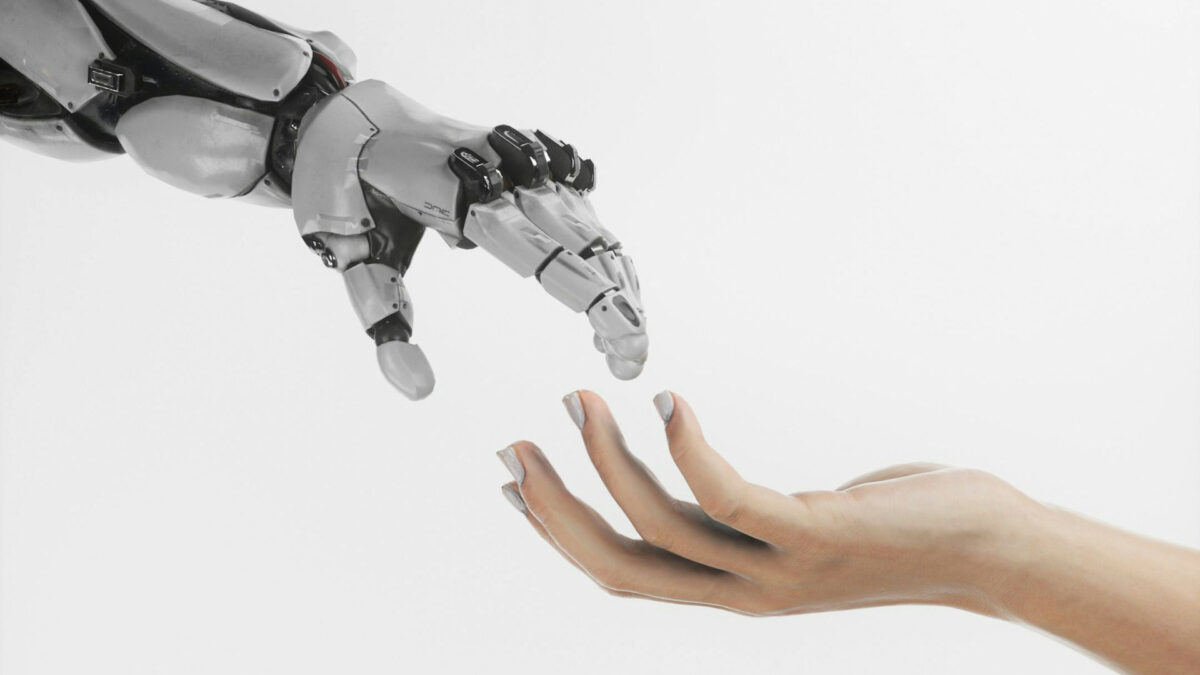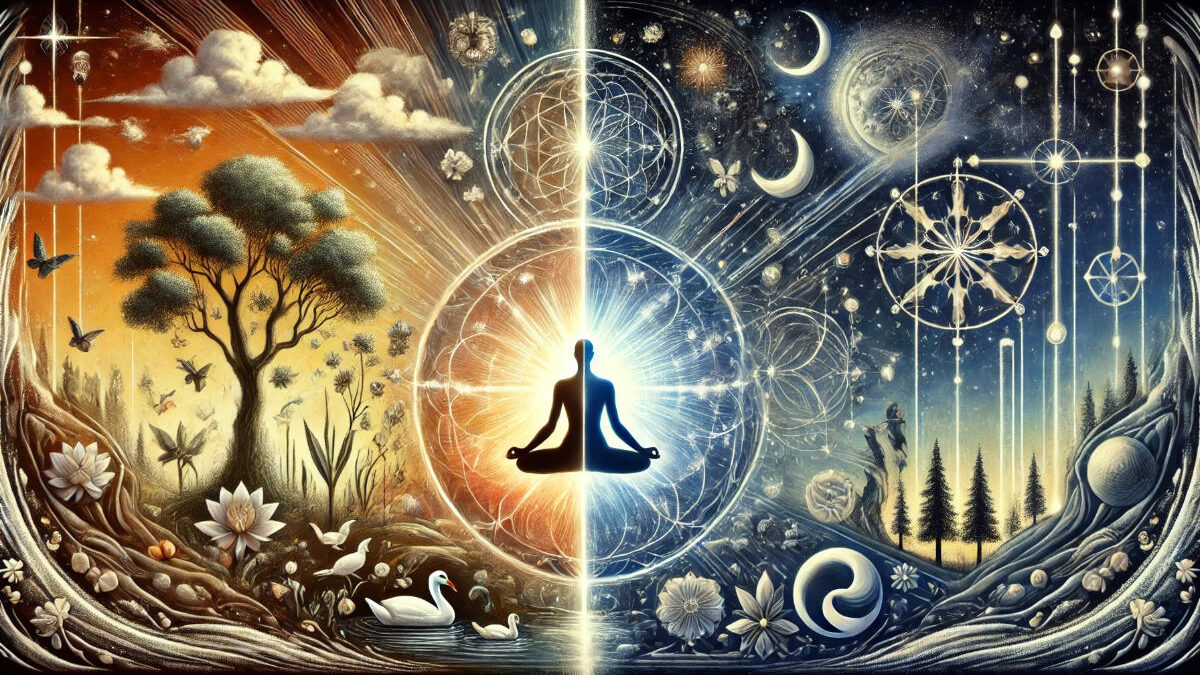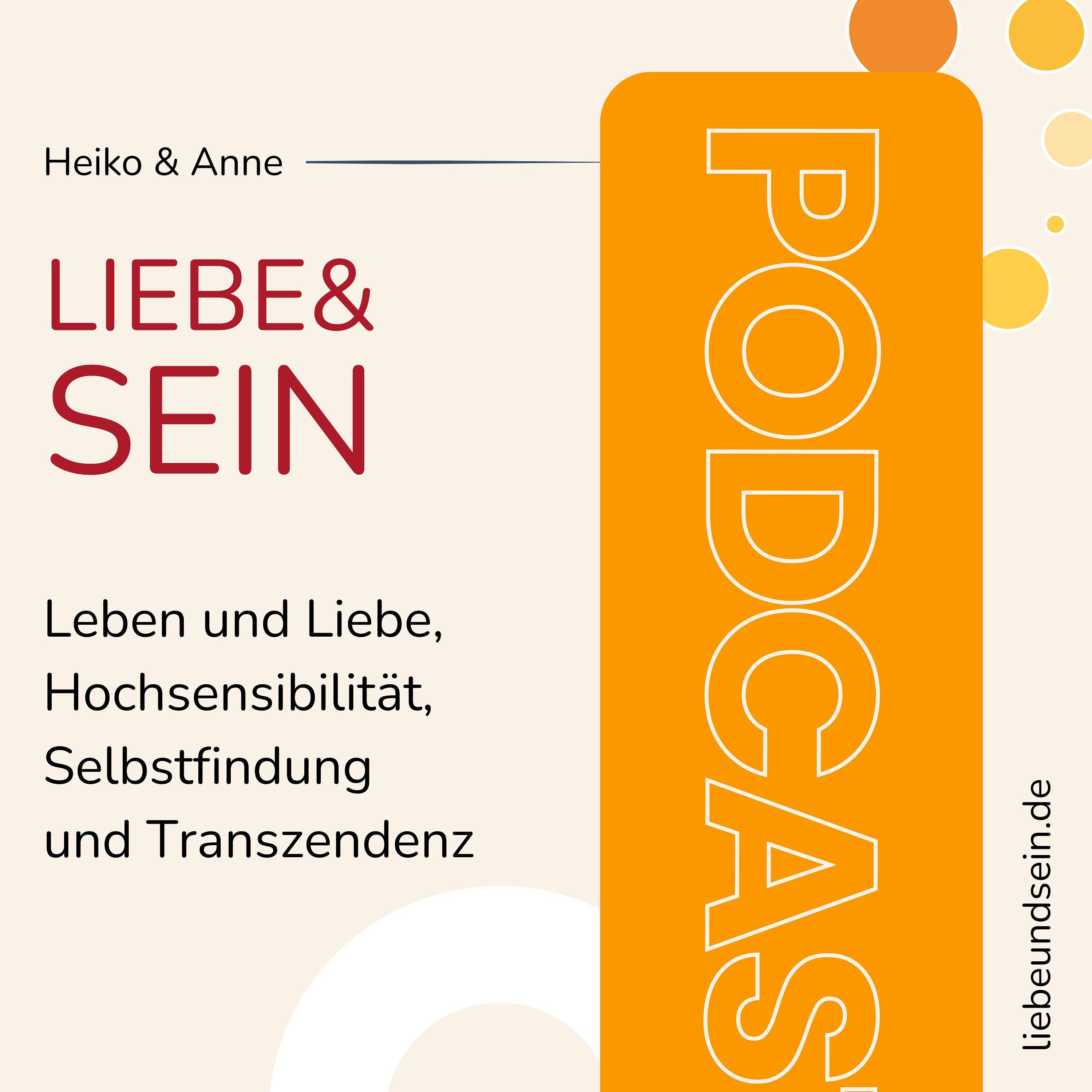
Der Kern unserer Arbeit ist die Selbstverwirklichung auf einer ganzheitlichen Art und Weise. Hierbei geht es nicht um das erreichen konkreter Ziele und Erfolge, sondern um die Erkenntnis, wer und was wir sind.
Seit vielen Jahren setzen wir uns mit den inneren Welten des Menschseins auseinander, waren und sind auf der Beratungsebene tätig und erleben das Leben als einen großen Erkenntnisprozess. Der Zeitgeist verändert sich immer stärker dahingehend, dass wir Menschen mit unserem Inneren konfrontiert werden. Mal sanft, mal weniger sanft… In den täglichen Herausforderungen und dem stetigen Wandel, ist es oft nicht einfach, den eigenen Weg zu finden.
Wir sprechen über unsere Erfahrungen und Erkenntnisse, möchten Werkzeuge und Methoden mit euch teilen. Wir möchten gemeinsam weiterlernen und uns mit euch austauschen.
Ich bin Heiko, der Host und meine Partnerin Anne wird gelegentlich den Podcast begleiten.
Du möchtest mehr von uns sehen und hören?
Unser Blog & Mini-Workshops – ein Ort für Selbstverwirklichung und Transzendenz, dem Leben und der Liebe…
https://liebeundsein.de/
Liebe&Sein auf YouTubehttps://www.youtube.com/@LiebeundSein
- Sherry Turkle, eine amerikanische Soziologin beschreibt in „Alone Together“, wie digitale Kommunikation zwar Nähe simuliert, aber oft weniger Beziehungsfähigkeit aufbaut, weil der direkte emotionale Abgleich fehlt.
- Jean Twenge,eine amerikanische Psychologin zeigt in „iGen“, dass jüngere Generationen zwar weniger riskante Situationen erleben, gleichzeitig aber häufiger unter Einsamkeit, Angst und Depression leiden.
- Neurowissenschaftliche Studien belegen, dass reale Interaktionen mehr Dopamin und Oxytocin freisetzen – Botenstoffe, die Bindung, Vertrauen und Wohlbefinden stärken – als digitale Kontakte.
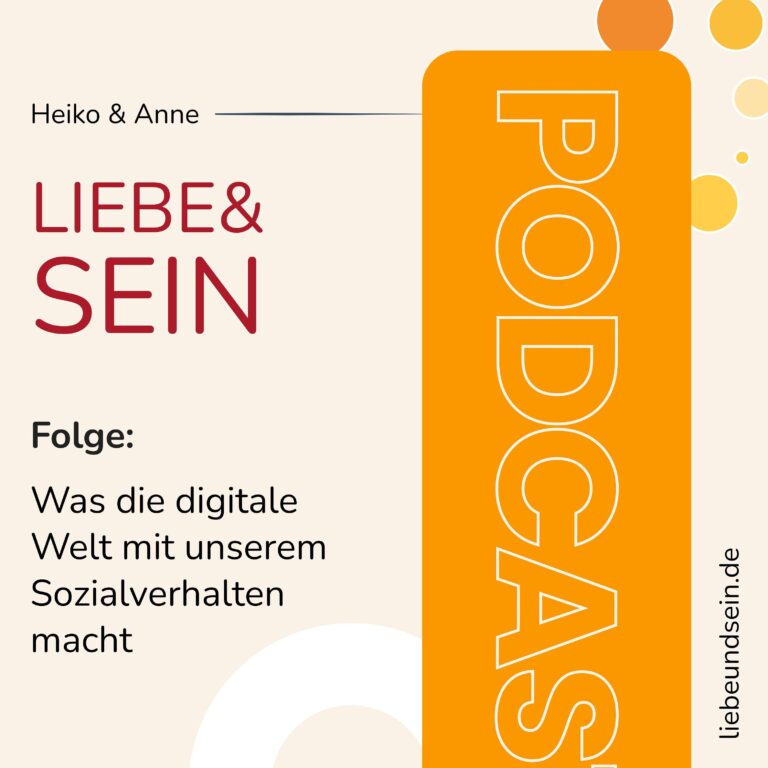
Das Script zum Podcast:
Ich denke manchmal darüber nach, was passiert, wenn die Menschen zum großen Teil nur noch digital kommunizieren und konsumieren? Wenn die Lebenserfahrungen immer mehr auf der „digitalen Ebene“ stattfinden?
In den letzten Jahrzehnten hat sich unser soziales Leben tiefgreifend verändert. Vieles, was früher selbstverständlich im direkten Kontakt stattfand, verlagert sich heute in den digitalen Raum. Wir treffen uns seltener spontan, viele Unterhaltungen laufen über Messenger, Konflikte werden per Chat geklärt – oder einfach durch Schweigen beendet.
Die digitale Welt hat ohne Frage ihre Vorteile: Sie verbindet über große Distanzen, ermöglicht den schnellen Austausch und bietet Zugang zu unendlich vielen Informationen. Doch mit dieser Verschiebung passiert etwas, das oft erst auf den zweiten Blick erkennbar ist: Es verändert sich die Art, wie wir Erfahrungen machen und wie wir sie verarbeiten.
Kognition statt Erfahrung
Wenn wir Erlebnisse im realen Leben haben, laufen mehrere Ebenen gleichzeitig: Wir sehen, hören, spüren die Atmosphäre, nehmen Mimik und Gestik wahr, fühlen vielleicht Anspannung oder Freude im eigenen Körper. All das prägt die Erfahrung tief und nachhaltig.
Im Digitalen fällt vieles davon weg. Wir erleben gefilterte, reduzierte Ausschnitte einer Situation – oft ohne unmittelbare körperliche Rückmeldung. Ein Streit von Angesicht zu Angesicht fordert uns ganz anders heraus als eine Diskussion in einer Kommentarspalte. Wir müssen Präsenz halten, die Worte des anderen aushalten, Kompromisse aushandeln. Online hingegen können wir den Chat schließen, blockieren oder einfach nicht mehr antworten. Die emotionale Intensität ist geringer – und damit auch der Lerneffekt.
Die „Standard-Identität“ im Digitalen
Das vielleicht größte Problem entsteht nicht sofort, sondern schleichend: Wenn eine Generation vor allem digitale Interaktion kennt, wird genau diese Form zur Standard-Identität.
Es fehlt nicht nur der Vergleich, sondern auch das Bewusstsein dafür, dass etwas fehlen könnte. Was für frühere Generationen ein Verlust wäre, ist für viele heute einfach normal.
Das hat Folgen: Fähigkeiten wie Kompromissbereitschaft, emotionale Resilienz oder soziale Intuition entwickeln sich vor allem durch reale, unmittelbare Erfahrungen. Wenn diese selten werden, werden auch diese Kompetenzen seltener trainiert. Es entsteht eine Art „blinder Fleck“ – nicht aus Absicht, sondern weil unsere Lebenswelt sie nicht mehr selbstverständlich fordert.
Unsichtbare Veränderungen
Das macht die Situation so tricky:
- Wir merken nicht, dass uns etwas fehlt, weil wir uns an die digitale Norm gewöhnt haben. Das Sozialverhalten wird mit anderen Parametern definiert.
- Die Bequemlichkeit digitaler Interaktion – Kontrolle, Planbarkeit, kein direkter Druck – bestärkt uns, dabei zu bleiben. Außerdem gibt diese Form auch natürlich Sicherheit, aufgrund von weniger direkten Kontakt und verminderter Verbindlichkeit.
- Reale Interaktion wirkt für manche immer anstrengender oder sogar bedrohlich – nicht nur weil sie ungewohnt geworden ist, sondern weil sie mehr zu verarbeitende Aspekte beinhaltet.
Wie wir gegensteuern können – ohne die Vorteile zu verlieren
Es geht nicht darum, die digitale Welt zu verteufeln. Sie ist längst Teil unserer Realität und bietet viele Chancen. Und ich glaube, dass dieser Prozess ein Schritt in einer Entwicklung ist… Aber ich glaube auch, wir brauchen eine gesunde Mischform:
- Erlebnisse schaffen: Begegnungen, bei denen echte Präsenz spürbar wird – ob im privaten Umfeld, in der Schule, im Beruf oder in Vereinen.
- Digitale Achtsamkeit: Sich bewusst fragen: „Würde ich diese Nachricht auch so sagen, wenn die Person vor mir sitzt?“
- Sozialkompetenz trainieren: Räume fördern, in denen Konflikte und Zusammenarbeit real erlebt werden.
- Positiv erlebbar machen: Den Unterschied nicht erklären, sondern erfahrbar machen – etwa durch gemeinsame Projekte, bei denen man merkt, wie viel erfüllender echte Zusammenarbeit sein kann.
💡 Es ist nicht nur mein Eindruck
- Sherry Turkle, eine amerikanische Soziologin beschreibt in „Alone Together“, wie digitale Kommunikation zwar Nähe simuliert, aber oft weniger Beziehungsfähigkeit aufbaut, weil der direkte emotionale Abgleich fehlt.
- Jean Twenge, eine amerikanische Psychologin zeigt in „iGen“, dass jüngere Generationen zwar weniger riskante Situationen erleben, gleichzeitig aber häufiger unter Einsamkeit, Angst und Depression leiden.
- Neurowissenschaftliche Studien belegen, dass reale Interaktionen mehr Dopamin und Oxytocin freisetzen – Botenstoffe, die Bindung, Vertrauen und Wohlbefinden stärken – als digitale Kontakte.
Warum das wichtig ist
Die Gefahr liegt nicht in der Technologie selbst, sondern darin, dass wir ihre Grenzen nicht mehr sehen. Wenn Verlust zur Normalität wird, fehlt uns die Motivation, ihn auszugleichen.
Mögliche Folgen? Vielleicht stärkere Empfindlichkeiten, mehr Egoismen, mehr Ängste, Distanz statt Nähe.
Deshalb brauchen wir nicht nur Gespräche darüber – sondern vor allem Räume, in denen wir die Tiefe, Wärme und Unmittelbarkeit realer Begegnung fühlen. Erst dann können wir den Wert dieser Erfahrungen bewusst in unser Leben einbauen.